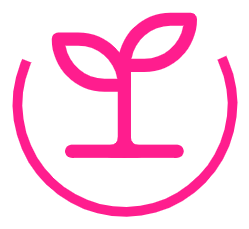Zwischen Flow und Flucht: Wenn Produktivität zur Selbstsabotage wird
Du glaubst, du arbeitest im Flow – aber eigentlich kämpfst du ums Überleben. Erkenne den Unterschied und hol dir deine Kraft zurück

Warum ich Aufgaben immer auf den letzten Drücker erledige – und was wirklich dahintersteckt.
Kennt ihr das?
Wochenlang ignoriert ihr eine Aufgabe – sagen wir: Steuererklärung.
Allein das Wort löst körperliches Unbehagen aus. Ihr wisst, dass ihr sie machen müsst. Aber nicht heute. Nicht jetzt. Morgen. Oder übermorgen.
Und dann kommt dieser Moment: Deadline. Der Druck ist so groß, dass es kein Entrinnen mehr gibt. Und plötzlich passiert etwas Seltsames.
Ihr fangt an.
Sortiert Unterlagen.
Der Taschenrechner klickt.
Daten fließen.
Ihr merkt gar nicht, wie sehr ihr versinkt. Keine Ablenkung. Kein Hunger. Kein Durst. Nur Fokus.
Und am Ende denkt ihr: Wieso hab ich das eigentlich so lange aufgeschoben?
War doch gar nicht so schlimm. Fast schon... befriedigend.
Ich dachte lange: Das ist mein Flow. Ich funktioniere halt am besten unter Druck.
Aber dann habe ich genauer hingeschaut.
Was aussieht wie Flow, ist oft Kampfmodus
In der Rückschau erkannte ich ein Muster.
Ich fange erst an, wenn der Druck von außen groß genug ist – weil ich innerlich blockiert bin.
Und sobald ich loslege, gerate ich nicht in einen Zustand von Leichtigkeit, sondern in einen Zustand von Flucht.
Das fühlt sich nicht wie Flow an.
Es ist eher wie: Ich hetze dem nächsten Problem davon.
Schneller sein als die Technik, die abstürzt.
Schneller als das nächste Hindernis, das um die Ecke lauert.
Schneller als der Anruf, der mich rausreißt.
Schneller als mein eigener Zweifel.
Es ist wie beim Häkeln mit zwei linken Händen: Zwei Maschen vor, drei zurück – und dann verknotet sich das Garn. Ich verliere mich in endlosen kleinen Katastrophen, die sich ineinander verhaken. Jedes Problem gebiert drei neue.
Und ich?
Ich verbeiße mich rein.
Ich trinke nicht. Esse nicht.
Ich mache keine Pause.
Ich will nur noch eins: Fertigwerden.
Der Moment danach – bittersüß
Wenn es geschafft ist, spüre ich kurz ein Hoch. Erleichterung.
Ein stiller Stolz.
Manchmal sogar Glück.
Aber er hält nie lange an.
Denn da ist schon das nächste To-Do.
Oder jemand mit einem neuen Problem, das gelöst werden will.
Und ehe ich mich versehe, bin ich wieder im Rennen. Wieder im Kampfmodus. Wieder im Überlebensmodus.
Ich merke, dass ich mich in einer Tretmühle bewege, deren Antrieb ich selbst bin.
Und das Fatale daran: Von außen sieht das alles leicht aus.
Ich wirke wie jemand, der alles im Griff hat.
„Du schaffst das doch eh immer!“ höre ich.
Und innerlich denke ich: Ja. Aber zu welchem Preis?
Vielleicht ist das kein Flow. Sondern Selbstsabotage
Die Wahrheit ist: Ich sabotiere mich selbst.
Ich verschiebe Dinge nicht, weil ich faul bin – sondern weil ich Angst habe, dass ich sie nicht hinbekomme.
Dass ich versage.
Dass es nicht funktioniert.
Und wenn ich sie doch mache – dann am liebsten unter maximalem Druck, weil ich mir so keine Schwäche erlauben darf.
Weil es dann keine Wahl mehr gibt.
Und vielleicht...
Vielleicht brauche ich diesen Druck nur, weil ich mir selbst nicht genug vertraue.
Vielleicht ist der vermeintliche Flow nur ein funktionierendes Notfallprogramm, das sich eingeschaltet hat, um das System am Laufen zu halten.
Wenn Handeln nur unter Druck geschieht, ist es kein Flow – sondern Überleben
Und was ich lange für meine Superkraft gehalten habe, war in Wirklichkeit ein Schutzmechanismus.
Ich fange langsam an, das zu erkennen.
Und ich frage mich:
Was wäre, wenn ich Aufgaben nicht mehr auf den letzten Drücker erledige?
Was wäre, wenn ich mir selbst erlaube, Dinge ohne Angst anzugehen?
Was wäre, wenn ich wieder unterscheiden lerne –
zwischen echtem Flow und innerer Flucht?
PS:
Falls du dich gerade wiedererkennst – keine Sorge.
Du bist nicht allein.
Und vielleicht ist das der erste Schritt:
Nicht härter zu kämpfen.
Sondern hinzusehen, warum du überhaupt kämpfst.