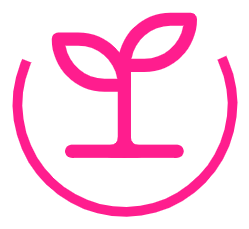Wenn Helfen weh tut: Die unsichtbaren Kosten der Selbstaufgabe
Du hilfst ständig anderen – aber wer hilft dir? Diese Geschichte zeigt, wie Helfen zur Selbstaufgabe wird – und wie du dich daraus befreist.

Wie ich lernte, dass Helfen nicht immer Liebe ist – sondern manchmal Selbstaufgabe.
Es beginnt immer harmlos.
Jemand braucht Hilfe.
Ein Anruf. Eine Nachricht. Ein fragender Blick.
Ich spüre den Impuls, bevor ich ihn bewusst denken kann: Ich mach das.
Ich springe rein. Ich übernehme. Ich löse. Ich rette. Ich funktioniere.
Und plötzlich bin ich mittendrin.
Im Problem eines anderen.
Das sich anfühlt wie meines.
Und das mich oft tiefer verschlingt als den, dem es eigentlich gehört.
Ich bin der Mensch, der’s regelt.
Ich bin die Person, die man fragt, wenn’s kompliziert wird.
Wenn Technik spinnt. Wenn Formulare nerven. Wenn es emotional wird.
Ich kann’s ja. Ich mach das ja immer.
Und ich tu’s nicht, weil ich muss – sondern weil ich nicht anders kann.
Aber was außen aussieht wie Selbstsicherheit, ist innen oft ein Kampf.
Denn während ich anderen helfe, verliere ich mich selbst.
Ich merke nicht, wie ich durstig bin.
Wie ich Hunger habe.
Wie mein Körper schreit: Pause!
Weil da nur noch ein Ziel ist: Fertigwerden.
Problem gelöst. Mission erfüllt. Weiter zum nächsten. Keine Zeit. Kein Raum. Kein Ich.
Ich war nie die, die sich zuerst fragt: Will ich das?
Ich sage oft Ja, bevor ich spüre, ob ich überhaupt helfen möchte.
Ich sage oft Ja, weil ich weiß, dass sonst niemand Ja sagen wird.
Ich sage oft Ja, weil ich gelernt habe, dass mein Wert sich daran misst, was ich für andere tue.
Und wenn ich mal Nein sagen will – dann wird aus meinem Nein ein neuer Konflikt.
Dann wird an mir gearbeitet.
Gedrückt. Gezogen. Getriggert.
So lange, bis es sich für mich schlechter anfühlt, nicht zu helfen, als zu helfen.
Also helfe ich.
Wieder.
Immer.
Zwanghaft.
Die Müllerstochter in mir
Es fühlt sich an wie im Märchen:
Ich bin die Müllerstochter, die Stroh zu Gold spinnen soll.
Aus Erwartungen. Aus Chaos. Aus fremden Problemen.
Ich soll das Unmögliche möglich machen – und irgendwie tu ich’s auch. Immer.
Aber zu welchem Preis?
Was keiner sieht: Ich bezahle mit meiner Energie.
Mit meiner Zeit. Mit meiner Selbstfürsorge.
Ich kämpfe mich durch fremde To-Dos, während andere schwimmen gehen. Sport machen. Abschalten.
Und wenn es vorbei ist?
Dann kommt selten ein Danke.
Oft nur ein Schulterzucken.
Oder schlimmer: „Ach, das hätte ich auch gekonnt.“
Das tut weh.
Denn tief in mir will ich gesehen werden.
Für meine Mühe. Meine Fürsorge.
Für das, was keiner merkt: Dass ich nicht einfach „nur helfe“, sondern mich jedes Mal selbst verliere.
Woher kommt das?
Ich kenne dieses Muster seit meiner Kindheit.
Ich war schon früh die, die sich kümmert. Die keine Hilfe erwartet. Die gibt, gibt, gibt – in der Hoffnung, gesehen zu werden.
Ich habe gelernt: Wenn ich für andere da bin, bekomme ich vielleicht Liebe.
Vielleicht Aufmerksamkeit.
Vielleicht Dank.
Heute weiß ich: Das ist ein Handel, den nie jemand abgeschlossen hat.
Ein Geschäft, das nur in meinem Kopf existiert.
Und das mich kaputtmacht.
Ich helfe. Aber nicht mehr um jeden Preis.
Ich fange an, mich zu fragen:
Warum nehme ich Probleme an, die nicht meine sind?
Warum trage ich Lasten, die andere nie zu mir gebracht hätten, wenn ich nicht so selbstverständlich ausstrahlen würde: Gib sie mir.
Warum fällt es mir so schwer, zu sagen: Nein. Nicht diesmal.
Und vor allem:
Warum glaube ich, dass mein Wert von meinem Einsatz für andere abhängt?
Die Antwort ist: Weil ich meine Grenzen nicht kannte.
Aber jetzt beginne ich, sie zu erkennen.
Ich spüre, dass Helfen schön sein kann – wenn es aus Freiheit kommt.
Nicht aus Zwang.
Nicht aus Angst.
Nicht aus einer alten Geschichte, die längst vorbei ist.
Ich will helfen, wenn ich will. Nicht, weil ich muss.
Ich will geben, ohne mich zu verlieren.
Ich will für andere da sein – und endlich auch für mich.